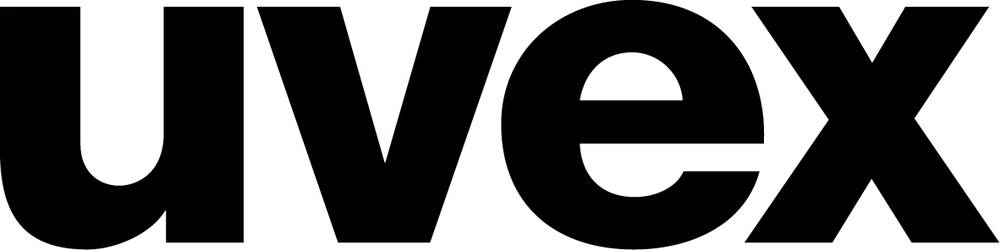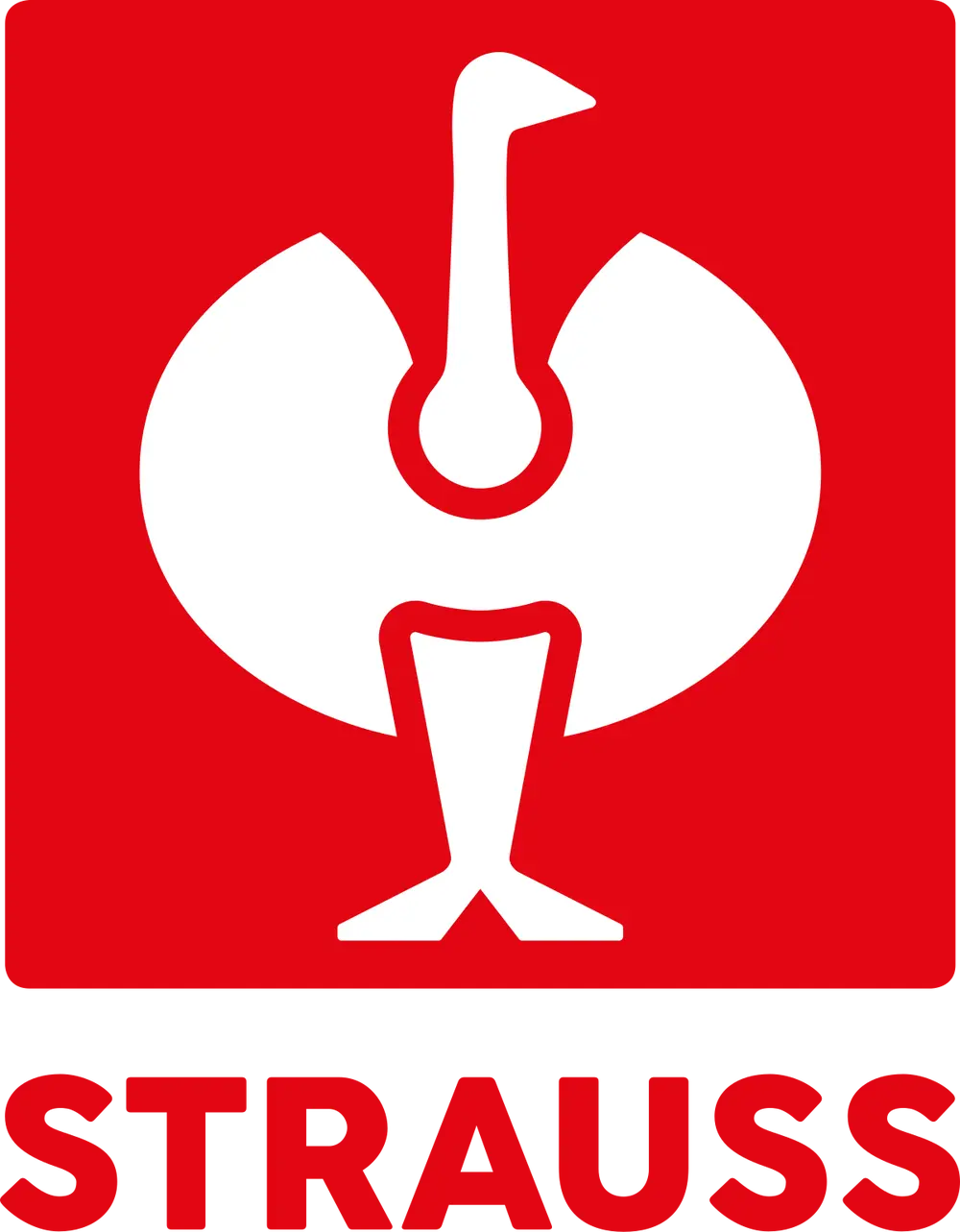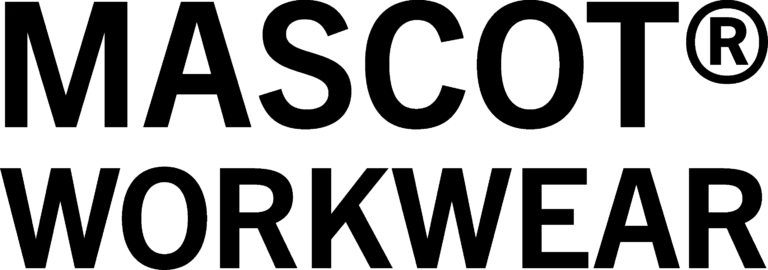Inhaltsverzeichnis:
Begriffserklärung und Zielsetzung von Sicherheitszertifizierungen
Sicherheitszertifizierungen sind mehr als nur ein Stempel auf einem Produktdatenblatt. Sie dienen als verbindlicher Nachweis, dass eine IT-Lösung, ein System oder ein Prozess gezielt und nachvollziehbar auf definierte Sicherheitsanforderungen geprüft wurde. Was steckt aber wirklich dahinter? Die Begrifflichkeit umfasst ein strukturiertes Prüfverfahren, das auf international oder national anerkannten Standards basiert. Das Ziel ist nicht bloß, irgendein Prüfprotokoll zu erfüllen, sondern ein objektives, nachvollziehbares Sicherheitsniveau zu dokumentieren – und zwar so, dass es für Dritte überprüfbar ist.
Die Zielsetzung solcher Zertifizierungen geht weit über reine Formalitäten hinaus. Sie schafft eine gemeinsame Sprache für Hersteller, Anwender und Prüfinstanzen. Dadurch wird es erst möglich, Produkte und Systeme nach einheitlichen Kriterien zu vergleichen und auszuwählen. Ein weiterer, oft unterschätzter Aspekt: Die Zertifizierung ist ein aktiver Schutzmechanismus gegen Cyberrisiken, denn sie zwingt Unternehmen dazu, Schwachstellen systematisch zu identifizieren und zu beheben. So entsteht ein nachhaltiger Sicherheitsgewinn, der nicht nur auf dem Papier existiert.
Interessant ist auch, dass Sicherheitszertifizierungen zunehmend als strategisches Instrument genutzt werden. Sie sind ein Schlüssel, um regulatorische Hürden zu meistern, das Vertrauen von Geschäftspartnern zu gewinnen und neue Märkte zu erschließen. Wer heute auf zertifizierte Sicherheit setzt, investiert also nicht nur in Technik, sondern auch in Reputation und Zukunftsfähigkeit.
Überblick über die wichtigsten Zertifizierungstypen: Produkt- und Systemzertifizierung
Produktzertifizierungen und Systemzertifizierungen markieren zwei grundverschiedene Herangehensweisen an das Thema IT-Sicherheit. Während die Produktzertifizierung den Fokus auf einzelne Hardware- oder Softwareprodukte legt, geht die Systemzertifizierung einen Schritt weiter und betrachtet das große Ganze – also die Wechselwirkungen zwischen Technik, Prozessen und Menschen.
- Produktzertifizierung: Hier steht die Prüfung eines spezifischen Produkts im Mittelpunkt. Typischerweise werden Sicherheitsfunktionen, Resistenz gegen Angriffe und die Einhaltung technischer Standards unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein Zertifikat, das dem Produkt eine definierte Sicherheitsqualität bescheinigt. Besonders relevant ist das etwa bei Firewalls, Verschlüsselungsmodulen oder Sicherheitschips.
- Systemzertifizierung: Diese Zertifizierungsform betrachtet die Sicherheit eines gesamten Systems – inklusive aller eingesetzten Komponenten, organisatorischer Abläufe und beteiligter Personen. Die Bewertung umfasst also nicht nur Technik, sondern auch Prozesse wie Zugriffskontrolle, Notfallmanagement und Schulungen. Das Ziel: Ein ganzheitlicher Schutz, der auch menschliche und organisatorische Schwachstellen berücksichtigt.
Der entscheidende Unterschied? Produktzertifizierungen liefern punktuelle Nachweise für einzelne Lösungen, während Systemzertifizierungen das Zusammenspiel und die Sicherheit im realen Betrieb absichern. Unternehmen sollten also je nach Anwendungsfall gezielt abwägen, welcher Zertifizierungstyp den eigenen Anforderungen am besten entspricht.
Pro- und Contra-Tabelle: Sicherheitszertifizierungen im Überblick
| Pro Argumente | Contra Argumente |
|---|---|
| Stärkung des Vertrauens bei Kunden, Partnern und Behörden | Oft hoher organisatorischer und finanzieller Aufwand |
| Zugang zu neuen Märkten und Teilnahme an Ausschreibungen | Zertifizierungen müssen regelmäßig erneuert und gepflegt werden |
| Objektiver Nachweis der Einhaltung von Sicherheitsstandards | Standardisiertes Prüfverfahren berücksichtigt nicht immer individuelle Unternehmensrisiken |
| Minimierung von Haftungsrisiken und Schutz vor Bußgeldern | Nicht jede Zertifizierung ist in allen Ländern oder Branchen anerkannt |
| Verbesserung und Standardisierung interner Prozesse | Kann Innovationszyklen verlangsamen, falls Anforderungen starr ausgelegt werden |
| Wettbewerbsvorteil durch professionelle Sicherheitskultur | Gefahr von "Zertifizierung als Selbstzweck" ohne tatsächlichen Sicherheitsgewinn |
| Erleichterte Zusammenarbeit in Lieferketten durch einheitliche Anforderungen | Fehlende Flexibilität bei dynamischen neuen Bedrohungsszenarien |
Die maßgeblichen internationalen und europäischen Sicherheitszertifizierungsstandards im Vergleich
Internationale und europäische Sicherheitszertifizierungsstandards setzen die Messlatte für IT-Sicherheit auf unterschiedlichen Ebenen. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer geografischen Reichweite, sondern auch in ihrer technischen Tiefe und ihrem Anwendungsbereich. Wer sich in diesem Dschungel zurechtfinden will, braucht einen klaren Vergleich.
- Common Criteria (CC): Dieser international anerkannte Standard (ISO/IEC 15408) ermöglicht es, IT-Produkte nach einheitlichen Kriterien zu bewerten. Besonders hervorzuheben ist die Skalierbarkeit: Die Evaluierungstiefe lässt sich anpassen – von grundlegenden Prüfungen bis hin zu sehr anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen. Das macht CC flexibel, aber auch komplex in der Anwendung.
- FIPS 140-3: Im Fokus steht hier die Sicherheit kryptografischer Module. Die US-amerikanische Norm ist Pflicht für viele Anwendungen im öffentlichen Sektor der USA. Sie setzt klare Anforderungen an Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Manipulationsschutz. Bemerkenswert: Es gibt vier Sicherheitsstufen, die je nach Risiko und Einsatzgebiet gewählt werden können.
- EUCC: Als europäisches Pendant zu den Common Criteria verfolgt EUCC das Ziel, Zertifizierungen für IT-Produkte in der EU zu harmonisieren. Besonders relevant ist das für Anbieter, die europaweit agieren wollen. Der Fokus liegt auf Interoperabilität und gegenseitiger Anerkennung innerhalb der EU.
- EUCS: Speziell für Cloud-Dienste entwickelt, adressiert dieses Schema die wachsenden Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität in Europa. Die Besonderheit: EUCS bezieht regulatorische Vorgaben wie die NIS2-Richtlinie und den Cyber Resilience Act explizit mit ein. Damit ist es für Unternehmen mit Cloud-Fokus praktisch unverzichtbar.
Fazit: Während internationale Standards wie CC und FIPS 140-3 vor allem technische Tiefe und weltweite Anerkennung bieten, setzen die europäischen Schemata auf regulatorische Konformität und Harmonisierung innerhalb der EU. Die Wahl des passenden Standards hängt stark vom eigenen Markt, den Produkten und den gesetzlichen Anforderungen ab.
Praxisnahe Beispiele für gängige Sicherheitszertifizierungen im Unternehmen
Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, branchenspezifische und allgemeine Sicherheitsanforderungen gleichermaßen zu erfüllen. Die Wahl der passenden Zertifizierung hängt oft von individuellen Risiken, gesetzlichen Vorgaben und der eigenen Marktposition ab. Hier einige praxisnahe Beispiele, wie Unternehmen Sicherheitszertifizierungen gezielt einsetzen:
- ISO/IEC 27001 für das Informationssicherheitsmanagement: Viele mittelständische Unternehmen nutzen diese Zertifizierung, um ein strukturiertes Managementsystem für Informationssicherheit nachzuweisen. Besonders gefragt ist sie bei Dienstleistern, die sensible Kundendaten verarbeiten – etwa in der Finanz- oder Gesundheitsbranche.
- BSI-IT-Grundschutz in der öffentlichen Verwaltung: Behörden und kommunale IT-Dienstleister greifen häufig auf dieses Zertifikat zurück, um die Einhaltung nationaler Sicherheitsvorgaben zu dokumentieren. Es wird regelmäßig im Rahmen von Audits überprüft und ist ein Muss für viele Organisationen mit kritischer Infrastruktur.
- FIPS 140-3 für Hardware-Sicherheitsmodule: Hersteller von Zahlungsterminals oder elektronischen Ausweissystemen lassen ihre Kryptomodule nach diesem Standard zertifizieren, um internationale Märkte zu erschließen und regulatorische Hürden zu überwinden.
- EUCS für Cloud-Dienstleister: Unternehmen, die Cloud-Services in Europa anbieten, setzen zunehmend auf diese Zertifizierung, um Kundenanforderungen an Datenschutz und Compliance zu erfüllen. Gerade bei europaweiten Ausschreibungen ist ein EUCS-Zertifikat oft ein entscheidendes Auswahlkriterium.
- Branchenzertifikate wie TISAX® in der Automobilindustrie: Zulieferer und Dienstleister müssen häufig branchenspezifische Zertifizierungen nachweisen, um mit großen OEMs zusammenarbeiten zu dürfen. TISAX® etwa prüft die Informationssicherheit entlang der gesamten Lieferkette.
Diese Beispiele zeigen: Sicherheitszertifizierungen sind längst kein Nischenthema mehr, sondern fester Bestandteil unternehmerischer Praxis – und oft der Türöffner für neue Geschäftsbeziehungen und Märkte.
Der konkrete Mehrwert von Sicherheitszertifizierungen für Unternehmen
Sicherheitszertifizierungen bieten Unternehmen weit mehr als bloße Nachweise – sie entfalten einen echten, spürbaren Mehrwert im täglichen Geschäft.
- Risikoabsicherung gegenüber Dritten: Zertifizierte Unternehmen können im Ernstfall nachweisen, dass sie branchenübliche Schutzmaßnahmen umgesetzt haben. Das reduziert im Schadensfall das Haftungsrisiko und stärkt die eigene Position gegenüber Versicherungen und Aufsichtsbehörden.
- Vereinfachung komplexer Ausschreibungen: In vielen Branchen sind Zertifikate ein Türöffner für Großaufträge. Sie ersetzen aufwendige Einzelprüfungen und erleichtern die Teilnahme an internationalen Ausschreibungen, weil sie als objektiver Sicherheitsnachweis akzeptiert werden.
- Effizienzsteigerung durch Standardisierung: Die Einführung zertifizierter Prozesse führt zu klaren Abläufen und Verantwortlichkeiten. Das spart Zeit, senkt Fehlerquoten und ermöglicht es, Ressourcen gezielter einzusetzen.
- Stärkung der Arbeitgebermarke: Gerade im Wettbewerb um IT-Fachkräfte ist eine nachgewiesene Sicherheitskultur ein Pluspunkt. Zertifizierungen signalisieren Professionalität und Verantwortungsbewusstsein – Eigenschaften, die qualifizierte Mitarbeitende schätzen.
- Verbesserte Zusammenarbeit in der Lieferkette: Wenn alle Beteiligten auf zertifizierte Sicherheitsstandards setzen, sinkt das Risiko von Schwachstellen an Schnittstellen. Das fördert reibungslose Kooperationen und schafft Vertrauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Unter dem Strich sind Sicherheitszertifizierungen ein strategisches Werkzeug, das nicht nur Risiken minimiert, sondern auch neue Chancen eröffnet und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärkt.
Schritt-für-Schritt: Auswahl und Implementierung passender Sicherheitszertifizierungen
Die Auswahl und Einführung einer passenden Sicherheitszertifizierung verlangt mehr als einen schnellen Haken auf der To-do-Liste. Wer planvoll vorgeht, spart Zeit, Kosten und Nerven – und erreicht tatsächlich das gewünschte Sicherheitsniveau.
- 1. Anforderungsanalyse: Zuerst sollten Sie klären, welche gesetzlichen, vertraglichen oder branchenspezifischen Vorgaben für Ihr Unternehmen gelten. Prüfen Sie auch, welche Erwartungen Kunden und Partner an Ihre IT-Sicherheit stellen. Das bildet die Basis für die Auswahl.
- 2. Auswahl des Zertifizierungsschemas: Nun gilt es, das Zertifikat zu identifizieren, das am besten zu Ihren Produkten, Dienstleistungen und Märkten passt. Berücksichtigen Sie dabei die Akzeptanz im Zielmarkt, den Prüfungsumfang und die Kompatibilität mit bestehenden Systemen.
- 3. Ressourcen und Zeitplan festlegen: Schätzen Sie realistisch ein, welche personellen und finanziellen Ressourcen benötigt werden. Ein klarer Zeitplan hilft, Meilensteine zu setzen und Verzögerungen zu vermeiden.
- 4. Gap-Analyse und Maßnahmenplanung: Analysieren Sie, welche Anforderungen bereits erfüllt sind und wo Nachbesserungsbedarf besteht. Erstellen Sie einen Maßnahmenkatalog, um die Lücken gezielt zu schließen.
- 5. Umsetzung und Dokumentation: Führen Sie die geplanten Maßnahmen durch und dokumentieren Sie alle relevanten Prozesse, Richtlinien und technischen Anpassungen. Die Nachvollziehbarkeit ist entscheidend für das spätere Audit.
- 6. Internes Audit und Korrekturen: Testen Sie vor der offiziellen Prüfung intern, ob alle Anforderungen erfüllt sind. Nutzen Sie die Ergebnisse, um letzte Schwachstellen zu beseitigen.
- 7. Externes Audit und Zertifizierung: Beauftragen Sie eine akkreditierte Prüfstelle. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie das Zertifikat – und können es aktiv in der Kommunikation nutzen.
Wer diese Schritte beherzigt, schafft eine solide Grundlage für nachhaltige IT-Sicherheit und signalisiert Verlässlichkeit nach außen. Und mal ehrlich: Wer will schon im Blindflug in die nächste Prüfung rauschen?
Sicherheitszertifizierungen als Wettbewerbsvorteil und zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
Sicherheitszertifizierungen sind heute ein echtes Ass im Ärmel, wenn es darum geht, sich im Markt abzuheben und regulatorische Hürden elegant zu nehmen.
- Marktzugang und Kundenbindung: In vielen Branchen – etwa im Gesundheitswesen, in der Finanzindustrie oder bei Cloud-Dienstleistungen – verlangen große Auftraggeber und öffentliche Stellen explizit den Nachweis bestimmter Zertifikate. Wer diese vorweisen kann, wird überhaupt erst als potenzieller Partner in Betracht gezogen. Gerade bei internationalen Ausschreibungen oder bei der Expansion in neue Märkte ist das ein Türöffner, der Wettbewerber ohne Zertifizierung schlicht ausschließt.
- Erfüllung dynamischer Gesetzeslagen: Die regulatorischen Anforderungen rund um Datenschutz, Cyber-Resilienz und IT-Sicherheit verändern sich rasant. Sicherheitszertifizierungen helfen Unternehmen, flexibel auf neue Gesetze und Richtlinien zu reagieren, da sie die Einhaltung technischer und organisatorischer Mindeststandards dokumentieren. Das erleichtert nicht nur die Zusammenarbeit mit Behörden, sondern schützt auch vor empfindlichen Bußgeldern.
- Reputationsschutz und Krisenfestigkeit: Im Fall eines Sicherheitsvorfalls können zertifizierte Unternehmen nachweisen, dass sie nach dem Stand der Technik gehandelt haben. Das schützt nicht nur vor Imageschäden, sondern kann auch juristisch entlastend wirken – ein Aspekt, der oft unterschätzt wird.
- Beschleunigte Innovationszyklen: Wer auf zertifizierte Prozesse und Produkte setzt, kann neue Technologien und Geschäftsmodelle schneller und sicherer einführen. Denn viele Zertifizierungsschemata sind so gestaltet, dass sie Innovation nicht ausbremsen, sondern durch klare Leitplanken ermöglichen.
Unterm Strich: Sicherheitszertifizierungen sind weit mehr als ein bürokratischer Akt – sie verschaffen Unternehmen handfeste Vorteile im Wettbewerb und bieten ein stabiles Fundament, um auf regulatorische Veränderungen souverän zu reagieren.
Orientierungshilfen: Wann und für wen sind Sicherheitszertifizierungen unerlässlich?
Die Notwendigkeit von Sicherheitszertifizierungen ist nicht für jedes Unternehmen gleich – es gibt jedoch klare Indikatoren, wann sie unverzichtbar werden.
- Kritische Infrastrukturen: Unternehmen, die zur sogenannten KRITIS zählen – etwa Energieversorger, Telekommunikationsanbieter oder Wasserwerke – sind gesetzlich verpflichtet, ihre IT-Sicherheit regelmäßig zertifizieren zu lassen. Hier gibt es schlichtweg kein „Vielleicht“.
- Verarbeitung besonders sensibler Daten: Wer mit Gesundheitsdaten, Finanzinformationen oder staatlichen Geheimnissen arbeitet, muss ein Höchstmaß an Sicherheit nachweisen. Ohne Zertifizierung ist der Zugang zu solchen Projekten praktisch ausgeschlossen.
- Lieferanten großer Konzerne: Viele internationale Unternehmen fordern von ihren Zulieferern verbindliche Sicherheitsnachweise. Wer sich in globalen Lieferketten behaupten will, kommt um Zertifizierungen kaum herum.
- Digitale Dienstleister mit Cloud- oder SaaS-Angeboten: Anbieter, die Daten für Dritte speichern oder verarbeiten, stehen besonders im Fokus von Aufsichtsbehörden und Kunden. Hier sind Zertifizierungen oft ein zentrales Auswahlkriterium.
- Unternehmen mit Expansionsplänen: Wer neue Märkte erschließen oder international wachsen möchte, stößt ohne anerkannte Zertifikate schnell an regulatorische Grenzen.
Zusammengefasst: Immer dann, wenn regulatorischer Druck, sensible Daten oder hohe Kundenanforderungen im Spiel sind, werden Sicherheitszertifizierungen zum Pflichtprogramm – und nicht zur Kür.
Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Nutzung von Sicherheitszertifizierungen
Die erfolgreiche Nutzung von Sicherheitszertifizierungen verlangt einen strategischen Ansatz, der weit über das reine Erfüllen von Prüfanforderungen hinausgeht.
- Frühzeitige Integration in Unternehmensprozesse: Zertifizierungen sollten von Anfang an in die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle eingebunden werden. So lassen sich teure Nachbesserungen und Verzögerungen vermeiden.
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung: Die Anforderungen an IT-Sicherheit entwickeln sich ständig weiter. Es empfiehlt sich, Zertifizierungsprozesse und -dokumentationen kontinuierlich zu aktualisieren, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.
- Einbindung aller relevanten Abteilungen: Die Verantwortung für Sicherheitszertifizierungen darf nicht allein bei der IT liegen. Auch Geschäftsführung, Einkauf, Personal und Recht sollten einbezogen werden, um Synergien zu nutzen und Risiken ganzheitlich zu adressieren.
- Transparente Kommunikation nach außen: Die aktive und nachvollziehbare Kommunikation von Zertifizierungen stärkt das Vertrauen bei Kunden, Partnern und Behörden. Ein klarer Nachweis kann auch in Krisensituationen ein entscheidender Vorteil sein.
- Gezielte Weiterbildung der Mitarbeitenden: Um den Nutzen von Zertifizierungen voll auszuschöpfen, ist es sinnvoll, Mitarbeitende regelmäßig zu schulen und für aktuelle Bedrohungen zu sensibilisieren.
Wer diese Empfehlungen beherzigt, kann Sicherheitszertifizierungen nicht nur als Pflicht, sondern als echten Mehrwert für Innovation, Wachstum und Resilienz im Unternehmen nutzen.
Erfahrungen und Meinungen
Zertifizierungen im Bereich IT-Sicherheit sind für viele Anwender eine wichtige Entscheidung. Sie bieten nicht nur Wissen, sondern auch berufliche Vorteile. Nutzer berichten, dass eine Zertifizierung den Einstieg in die IT-Sicherheitsbranche erleichtert. Besonders im Hinblick auf die Karrierechancen ist eine Zertifizierung oft entscheidend.
Ein Anwender beschreibt, dass er nach dem Erwerb seiner Zertifikate direkt bessere Jobangebote erhielt. Er betont, dass die Kenntnisse, die durch die Zertifizierung vermittelt werden, oft in der Praxis angewendet werden können. Dies steigert das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Anerkennung durch Kollegen.
Ein häufiges Thema in Diskussionen ist die Dauer des Lernens für Zertifikate. Anwender auf Plattformen wie Reddit berichten von unterschiedlichen Lernzeiten. Einige schaffen es, innerhalb weniger Wochen eine Zertifizierung zu erlangen. Andere benötigen Monate. Dies hängt stark vom individuellen Lerntempo und der Vorkenntnis ab.
Ein Problem, das Nutzer häufig ansprechen, ist der Kostenfaktor. Zertifizierungen sind oft teuer. Anwender äußern Bedenken, ob sich die Investition langfristig lohnt. Einige berichten, dass die Gehaltserhöhung nach dem Erwerb der Zertifikate oft nicht die Erwartungen erfüllt. Dennoch gibt es auch Stimmen, die sagen, dass die berufliche Weiterentwicklung und die erhöhten Jobchancen die Kosten rechtfertigen.
In Berichten von Fachleuten wird deutlich, dass die kontinuierliche Weiterbildung in der IT-Sicherheit unerlässlich ist. Anwender, die sich nicht regelmäßig fortbilden, riskieren, den Anschluss zu verlieren. Die Schnelllebigkeit der Branche erfordert ständige Anpassung und Lernen.
Nutzer zeigen auch, dass die praktische Anwendung der erlernten Inhalte entscheidend ist. Viele berichten von positiven Erfahrungen in der Umsetzung des Gelernten im Arbeitsalltag. Die Verbindung von Theorie und Praxis wird als besonders wertvoll empfunden. Auch die Möglichkeit, durch Zertifikate ein Netzwerk aufzubauen, wird häufig hervorgehoben.
Kritisch bleibt die Frage der tatsächlichen Sicherheit. Einige Anwender äußern, dass Zertifizierungen nicht immer ein vollständiges Bild der tatsächlichen Fähigkeiten vermitteln. Sie betonen, dass Erfahrung und praktische Kenntnisse oft wichtiger sind. In der IT-Sicherheit zählt letztlich nicht nur das Papier, sondern auch das Können.
Zusammenfassend zeigen die Erfahrungen von Nutzern, dass Sicherheitszertifizierungen sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Sie bieten wertvolle Kenntnisse und können die Karriere fördern. Gleichzeitig bringen sie Herausforderungen mit sich, insbesondere in Bezug auf Kosten und tatsächliche Anwendung im Beruf.
FAQ zu Sicherheitszertifizierungen: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Was ist der Zweck einer Sicherheitszertifizierung?
Der Zweck einer Sicherheitszertifizierung besteht darin, nachweislich zu dokumentieren, dass ein IT-Produkt, System oder Prozess definierte Sicherheitsanforderungen erfüllt. Sie schafft Vertrauen bei Geschäftspartnern und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Welche Arten von Sicherheitszertifizierungen gibt es?
Man unterscheidet zwischen Produktzertifizierungen und Systemzertifizierungen. Produktzertifizierungen prüfen die Sicherheit einzelner Hardware- oder Softwareprodukte, während Systemzertifizierungen das Zusammenwirken von Technik, Prozessen und Personen im gesamten System bewerten.
Welche internationalen und europäischen Standards sind maßgeblich?
Zu den wichtigsten internationalen Standards zählen die Common Criteria (ISO/IEC 15408) und FIPS 140-3. Auf europäischer Ebene sind vor allem EUCC für Produkte sowie EUCS für Cloud-Dienste maßgeblich. Diese Schemata fördern die Harmonisierung der IT-Sicherheitszertifizierung in Europa.
Welchen Nutzen haben Unternehmen von einer Sicherheitszertifizierung?
Sicherheitszertifizierungen schaffen einen objektiven Sicherheitsnachweis, verschaffen Wettbewerbsvorteile, erleichtern die Teilnahme an Ausschreibungen, fördern die Prozessstandardisierung und helfen, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Für wen sind Sicherheitszertifizierungen besonders wichtig?
Sicherheitszertifizierungen sind insbesondere für Unternehmen aus kritischen Infrastrukturen, Dienstleister mit sensiblen Daten, Cloud-Anbieter und Organisationen, die als Lieferanten für Großunternehmen tätig sind, unerlässlich. Sie sind auch für Unternehmen, die internationale Märkte erschließen möchten, von großer Bedeutung.